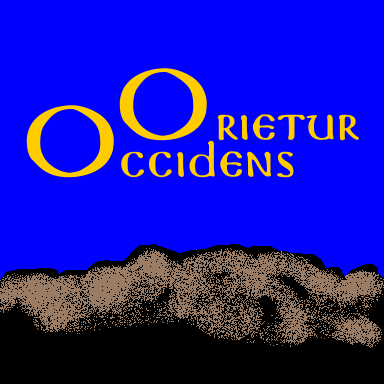Die Liturgie lebt von den Gesten. An ihnen zeigt sich, daß die, die mitfeiern, wirklich die Liturgie, die Begegnung mit dem Herrn erleben.
Darum hat auch die Konstitution des II. Vaticanum über die heilige Liturgie Sacrosanctum concilium angeordnet (31.), daß bei der Überprüfung der liturgischen Bücher sorgfältig darauf zu achten sei, daß die Rubriken auch die Anteile der Gläubigen, also auch deren Gesten, vorsehen – in den älteren liturgischen Büchern waren nur die Anteile des Zelebranten, der Ministranten und der Chorassistenz dargestellt worden.
Die Gesten des Volks einzubeziehen ist jedoch in den neuen liturgischen Büchern nur ganz wenig geschehen. Allerdings ordnet Sacrosanctum concilium (28.) auch an, daß in den liturgischen Feiern jeder das tun soll, was ihm der Natur der Sache nach und den liturgischen Normen nach zukommt. Liturgische Normen sind natürlich nicht nur die geschriebenen Normen, sondern auch die, die sich im Laufe der Zeit aus „der Natur der Sache“, aus dem Erleben der Liturgie heraus ausgebildet haben und im Klerus und im Volk, oft stillschweigend, überliefert worden sind.
Alle liturgischen Gesten sind Ausdruck, Ausdruck der Ergriffenheit, der Verehrung – Verneigungen, Kniebeugen –, der demütigen Verbundenheit – Kreuzzeichen. Sie müssen in ihrer Ausführung dieser Haltung, diesem Erleben entsprechen.
Der Altar ist es, auf dem wieder und wieder das Opfer des Herrn Wirklichkeit wird; darum kommt ihm höchste Verehrung zu. Gute Tradition ist es, daß der Priester im Ornat jedesmal (jedesmal!), wenn er an ihn tritt oder an ihm vorbeigeht, sich verneigt. Die Grundordnung des Römischen Messbuchs (122.) hat diese Beschränkung auf eine tiefe Verneigung ausgedehnt auf all die, die mit ihm an den Altar treten; jeder andere (also auch ein Priester, der nicht zelebriert) macht statt dessen eine Kniebeuge. Ähnlich ist es vor einem Kreuz, das Symbol jenes Opfers ist.
Es ist zumindest eine tiefe Verneigung, wie die Grundordnung ausdrücklich anordnet, nicht nur ein Kopfnicken, dabei still stehend, nicht etwa nur im Vorübergehen – eben ein Ausdruck der Ergriffenheit, der Verehrung. Was aber, wenn der Priester, der Ministrant, der Lektor oder der schlichte Gläubige im Kirchenschiff diese Ergriffenheit, diese Verehrung nicht spürt? Er halte inne, vergegenwärtige sich, vor welchem Mysterium tremendum (so Rudolf Otto) er steht, und vollziehe dann diese Geste mit besonderer Achtsamkeit – die achtsam ausgeführte Geste kann etwas an Empfinden mit sich ziehen.
Dem Altar gilt (zusammen mit dem Tabernakel, solange nicht das Allerheiligste anderswo ist, etwa bei der Kommunionausteilung oder einer Prozession) die größte Verehrung; er steht im Mittelpunkt aller Aufmerksamkeit. Tritt jemand während des Gottesdienstes oder auch davor oder danach zu irgendeinem Dienst aus dem Kirchenschiff in den Altarraum, so wird er zuerst dem Altar seine Verehrung erweisen, bevor er dann an eine andere Stelle geht, ans Lesepult etwa oder an den Kredenztisch. Zurückgehen mag er danach auf direktem Weg.
Das priesterliche Amt bezieht sein Wesen aus dem Opfer des Herrn, dessen Ort der Altar ist. Darum achte der Priester bei allen liturgischen Funktionen, die am Altar stattfinden, daß er nahe am Altar steht, sich so ihm eng verbunden erweist; ein, zwei Schritte wegzutreten und ungerührt einfach mit der Liturgie fortzufahren oder gleich, nach den Vermeldungen, vom Lesepult aus den Segen zu geben macht diese Verbindung unklar. Und natürlich blickt der Priester, wenn er sich nicht gerade, etwa bei einem liturgischen Gruß, der Gemeinde zuwendet, auf den Altar und auf die Opfergaben, wenn sie bereits darauf liegen. Er kann nicht, um ein Gemeindelied mitzusingen, zum Sanctus etwa, das Gotteslob über den Altar halten, um dahinein zu schauen. Das klingt nach einer Quisquilie; doch man sieht es, daß da etwas schräg ist, daß es nicht zusammenpaßt.
„Andacht“ heißt es; alle liturgischen Gesten müssen im Gedenken an das, was da geschieht, an den, um den es in der Liturgie geht, ausgeführt werden. Nur andeutungsweise oder hastig ausgeführte Gesten sind verheerend.
Aber auch das Gegenteil kann der Liturgie abträglich sein. Einmal habe ich eine junge Frau beobachtet, die die ganze Zeit des Gottesdienstes hindurch ständig wechselnde Gebetsgesten vollzieht: sie faltet die Hände, erhebt sie in verschiedener Weise – durchaus nicht ausladend oder ostentativ –, bekreuzigt sich, verneigt sich. Das mag exzentrisch erscheinen oder auch zwanghaft, aber es ist echt, Ausdruck ihrer persönlichen Frömmigkeit. Wenn aber ein Priester am Altar liturgische Gesten, Kreuzzeichen, Verneigungen, das Erheben oder Ausbreiten der Hände, in ganz betont ausgeprägter Form, weit ausladend, ausführt, so kann es sein, daß es geradezu demonstrativ erscheint. Und so mag es auch gemeint seien. Das zeigt, daß er dabei nicht innerlich dem Herrn zugewandt ist, sondern beim Volk ist, ihm etwas demonstrieren will. Und so ist das, was er demonstriert, eben nicht die Hinwendung zum Herrn, sondern nur sein eigener Wunsch, Vorbild oder Lehrmeister zu sein.