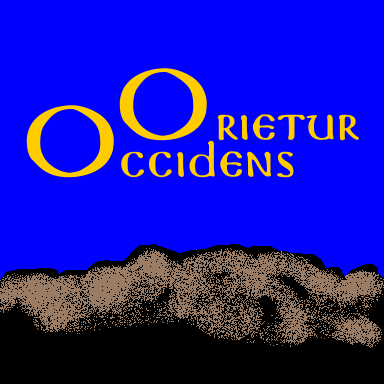Mittwoch, 30. Dezember 2020
Morgengrauen um 10 Uhr morgens?
Doch nun hat am Weihnachtstag solch ein Lebensgefühl in unserer Kirche die Oberhand gewonnen.
Mittwoch, 23. Dezember 2020
Lehren aus dem Advent unter dem Regime der Viren
2. Neue virologische Erkenntnis, die den Virologen entgangen ist: Wenn wer schweigt (der Zelebrant etwa), auch wenn er ganz alleine da steht oder sitzt, muß er einen Atemschutz tragen. Wenn er aber spricht, ist der nicht mehr so wichtig; er kann ihn dann solange abnehmen. (Habe ich da etwas falsch gemacht? – auch bei einem einstündigen Vortrag habe ich das Ding aufbehalten.)
3. Hellgrünblauer Atemschutz zu violettem Ornat: das geht nicht (gelber auch nicht).
4. Traditionelle Adventspräfation, wie sie etwa in Le Barroux gesungen wird.
Freitag, 18. Dezember 2020
.. und morgen früh die Liturgie des Quatembersamstags
So ärgerlich das Confinement auch ist, so traurig dessen Anlaß, es bringt uns doch den Nutzen, daß wir wieder – wie seinerzeit schon ausführlich besprochen – im Netz an den Messen von Le Barroux teilnehmen können. Da bei uns in Deutschland die Messen in unseren Kirchen weiterhin zugänglich sind, wenn auch mit begrenzter Teilnehmerzahl, ist das für die meisten und so auch für mich in der Regel nicht von Bedeutung; doch an den festlichen Quatembermessen teilzunehmen (morgens im Anschluß an die Terz um halb zehn) lasse ich mir nicht entgehen, und ebensowenig, bei den Vespern mitzusingen, in denen in diesen Tagen die O-Antiphonen in ihrem natürlichen Biotop erscheinen.
Anmerkung: die Freude an der Quatemberliturgie ist natürlich nur vollkommen, wenn man an diesen Tagen auch fastet.
Freitag, 4. Dezember 2020
„Generisches Maskulinum“ – gibt es das?
Grundsätzlich besprochen wurde anderswo die Frage schon vor mehr als drei Jahren: Dichterin oder Dichter? Zum generischen Maskulinum.
Wir nun haben uns darangemacht, die Frage von dem her, was die Bedeutung der Sprache bestimmt, nämlich vom wirklichen Sprachgebrauch her zu untersuchen.
Montag, 30. November 2020
Das Gerücht, Bergkarabach gehöre völkerrechtlich zu Aserbaidschan,
Die aktuelle Rechtslage zum Status der Republik Artsakh (Berg-Karabach)
Und von ihr wurde Strafanzeige erstattet (die Zerstörung von Kulturgütern ist ein anderes Thema):
Pressemitteilung / Strafanzeige beim Generalbundesanwalt in Karlsruhe wegen Kriegsverbrechen gegen Personen im aktuellen Berg-Karabach-Krieg durch aserbaidschanische Soldaten
Mittwoch, 25. November 2020
Abendländische Werte, zu verteidigen gegen falsche Freunde
Orietur Occidens, die „Interessengemeinschaft Abendland“, nimmt Stellung.
Montag, 23. November 2020
Nachlese zum Krieg gegen Karabach
«Menschenrechtsorganisationen berichten von Streubomben gegen die Zivilbevölkerung, von gezielten Angriffen auf Krankenhäuser und Kirchen, weil sie christliche Kreuze trugen. Kriegsgefangene Armenier sollen gefoltert und dabei gefilmt worden sein. ... Videos von Hinrichtungen haben die Hohe Kommissarin für Menschenrechte der Vereinten Nationen, Michelle Bachelet, zu einem Alarmruf veranlasst ...
... Man müsse die Region „von den Ungläubigen befreien“, hat Erdogan den Religionskrieg ausgerufen.»
Donnerstag, 19. November 2020
Die Türkei will Truppen nach Bergkarabach schicken
Zur Erinnerung: Nach ersten Ansätzen seit 1895 hat der türkische Staat seit 1915 einen Völkermord an Armeniern und Aramäern verübt, dem wohl weit über eine Million Christen zum Opfer fielen, den aber die Türkei bis heute leugnet. Als nach dem I. Weltkrieg das türkische Reich aufgeteilt wurde, blieben die neugeschaffenen arabischen Länder wie Syrien, der Iraq, Palästina und Transjordanien, die zunächst französisches oder englisches Mandatsgebiet wurden, frei (ausgenommen der syrische Sandjak Alexandrette, der schließlich doch wieder annektiert wurde), während andererseits die Türkei nicht nur die zuvor türkisch beherrschten Gebiete der vom Friedensvertrag von Sèvres anerkannten Republik Armenien zurückeroberte, sondern darüber hinaus auch zuvor zum Zarenreich gehörende armenische Gebiete bis hin zum Araxes, so daß der Ararat, der heilige Berg Armeniens, nun für Armenier zwar noch zu sehen, aber nicht mehr zugänglich ist. Siehe auch: zwei (1.) - (2.) Nachträge
Dienstag, 17. November 2020
„Islamistische“ Morde
Dieser Mord war ein zutiefst verwerfliches Verbrechen; nur: was hatte der Unterrichtsgegenstand, den dieser Lehrer behandelt hatte, damit zu tun, «zu Bürgern dieses Landes» zu werden», «Republikaner hervorzubringen»?
Angemerkt sei: natürlich hat die Kolonialherrschaft auch Gutes gebracht, so die Befreiung von den Sklavenjägerstaaten Westafrikas; aber das rechtfertigt nicht das in diesem Artikel beschriebene Vorgehen der Kolonialmacht.
Samstag, 14. November 2020
Das Kirchenjahr
Ein Vergleich des Ordo des Laterans mit Durands Rationale Divinorum Officiorum, der ältesten Quelle, die die Duplex-Feste auflistet, hätte genügt: bei Durand erscheinen als Duplex-Feste die, die im Lateran doppelte Antiphonen haben, nicht die, die doppelte Vigilien haben.
Schon seit mehr als einem Jahr stehen bei uns Tabellen im Netz, die das aufzeigen, die sich um Vollständigkeit bemühen. Doch diese Tabellen bedurften noch einiger Ergänzungen und Präzisierungen. Die sind nun geschehen; so lohnt ein neuer Blick auf unser Tabellenwerk.
Ebenfalls seit mehr als einem Jahr steht, im Anschluß daran, der Artikel des E&E-Heftes 23 im Netz, der das Kirchenjahr als System darzustellen sich bemüht, wie es sich von den Anfängen an in der ganzen Kirche des Ostens und Westens und im besonderen im Raum des römischen Ritus entwickelt hat. Auch hier zeigte es sich, daß zu dem Artikel einige Ergänzungen wünschenswert waren; so habe ich jetzt an St. Martin einen Satz über das Martinsfasten hinzugefügt. Diese Ergänzungen sind nun – gekennzeichnet – seiner html-Fassung eingefügt.
Während sich das Kirchenjahr bis zu Beginn der Neuzeit nur ganz allmählich entwickelt hatte und im wesentlichen bestehen blieb, kam es seither zu einer immer größeren Menge von Veränderungen, die schließlich dazu führten, daß das ganze System ins Wanken geriet und dann grundlegenden Novellierungen unterzogen wurde. Diese Veränderungen als System, mit ihren Ursachen darzustellen ist das Thema des Anschlußartikels im E&E-Heft 24. Auch der ist nun in html-Fassung ins Netz gestellt.
Waffenstillstand und Hoffnung auf Frieden
«Vor Ausbruch des Krieges im Jahr 1988 waren circa zwei Drittel der Einwohner Schuschis aserbaidschanisch», lese ich; und anderswo steht ähnliches. Doch in Meyers Konversationslexikon von 1907 steht s.v. Schuscha über die Einwohner der Stadt: «meist Armenier». 1916 seien es laut Wikipedia noch 53,3 % gewesen, bis es 1920, vor allem durch « aserbaidschanische und türkische Armeesoldaten», zum Pogrom gegen die armenischen Bewohner kam, das «zu deren weitgehender Auslöschung» führte. «Die Armenierviertel der Stadt Schuscha wurden dabei vollständig zerstört» (Wikipedia s.v. Schuscha-Pogrom).
1992 von Karabach erobert, ist Schuschi nun wieder in aserbaidschanischer Hand.
Rußland wird von der EU sanktioniert – aus durchaus guten Gründen; aber nicht weniger Grund gäbe es, die Türkei und Aserbaischan zu sanktionieren. Doch «Deutschland blockiert europäische Sanktionen gegen Ankara» (Telepolis). «Noch Ende Oktober hatte Außenminister Heiko Maaß erklärt, die internationale Gemeinschaft werde eine militärische Lösung im Konflikt um Bergkarabach nicht akzeptieren» (tagesschau.de); und nun hat diese «internationale Gemeinschaft» durch Untätigkeit dafür gesorgt, daß Aserbaidschan die Früchte seines militärischen Vorgehens einbringen kann. Das einzige Land aber, von dem Armenien und Bergkarabach überhaupt irgendwelchen Schutz erwarten können, ist Rußland.
Nachtrag aus Tigran Petrosyan: Krieg aus der Ferne:
«Nach der Sowjetisierung des Südkaukasus gliederten die Kommunisten am 4. Juli
1921 Bergkarabach in die armenische Sowjetrepublik ein. Als Antwort
darauf protestierten die aserbaidschanischen Vertreter in Moskau und meldeten
ihren Anspruch auf Bergkarabach an. Am nächsten Tag schlug Josef Stalin
Bergkarabach als armenisches Autonomiegebiet der Sowjetrepublik Aserbaidschan
zu.»
---
«Das Jahr 1988 sei ein einziger Horror gewesen. .... Immer die Bilder der
Stadt Sumgait im Kopf, wo Armenier*innen totgeschlagen und vertrieben worden
waren.
„An einem Abend kam meine Schwester weinend zu uns und berichtete, dass eine
Gruppe aserbaidschanischer Männer in ihr Haus eingebrochen sei und die Möbel
zerhackt habe“, erzählt M... Ärzte durften Armenier*innen nicht mehr in den
Klinken behandeln. Schwangere entbanden in Kirchen. ...
Sie erinnert sich aber auch an gute aserbaidschanische Nachbarn, die mit den
Armeniern gemeinsam nachts draußen Wache hielten und ihnen bei der Flucht
halfen.»
Donnerstag, 5. November 2020
Islamistische Gewalttäter in großer Zahl aktiv
Dienstag, 3. November 2020
Der Eroberungskrieg schreitet fort
Daß Bergkarabach völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehört, ist immer wieder zu lesen. Das ist richtig: infolge eines Beschlusses der sowjetischen Staatsführung gehört das seit alter Zeit ganz überwiegend von Armeniern besiedelte Karabach völkerrechtlich zu Aserbaidschan, ebenso wie Nordzypern, das einen türkischen Bevölkerungsanteil hatte, völkerrechtlich zu Zypern gehörte, als es vom türkischen Militär für die Gründung eines türkischen Staates freigekämpft wurde (die Übergriffe des griechisch-zypriotischen Putschistenführers Nikos Sampson gegen die türkische Minderheit lieferte freilich der damaligen türkischen Regierung guten Grund zum Eingreifen), ebenso wie das Kosovo völkerrechtlich zu Serbien gehörte, als es von der NATO freigekämpft wurde.
Haß erzeugt Haß; es schmerzt, zu sehen, daß es auch armenische Übergriffe gegen Aseris gegeben hat, daß auch die Armee Karabachs Wohnbauten zumindest mit beschossen hat, als sie militärische Anlagen unter Beschuß genommen hat.
Das ist nicht zu rechtfertigen; wenigstens beschönigt das niemand als „Kollateralschäden“, wie damals die NATO es bei ihrem Krieg ums Kosovo gegen Serbien tat. Doch der Haß, den die Gewalt der einen Seite auf der anderen Seite auslöst, entschuldigt nicht die Gewalt, die am Anfang stand. Und systematischen Beschuß ziviler Ziele, vor allem der Hauptstadt Karabachs, Stepanakert, gibt es jetzt anscheinend durch das aserbaidschanische Militär.
Als Phileirenos zu bloggen habe ich in Armenien, in Eriwan begonnen, um meiner Begeisterung Ausdruck zu geben über das, was ich mit armenischen Menschen erlebt habe. Und daß nun Armenier in einen Krieg gedrängt worden sind, der wohl Tausenden Menschen beider Nationen das Leben oder die körperliche Unversehrtheit kostet und noch kosten wird, der noch viel mehr Menschen die Wohnung kostet und noch kosten wird durch Beschuß oder Vertreibung, das schmerzt.
Montag, 2. November 2020
Der Text des
„Großen Glaubensbekenntnisses“ im GL:
ein Mißverständnis
Warum?
Man könnte natürlich an eine Mystifikation denken à la «In der Messe treten die Gläubigen als Gemeinde gemeinsam auf, also muß es „wir“ heißen, nicht „ich“». Aber gegen solch platte Erklärung steht, daß im deutschen Apostolicum richtig „Ich glaube“ steht. Es muß also einen anderen Grund geben.
Es dürfte dieser sein:
Das Nicæno-Constantinopolitanum ist zunächst als Bekenntnis und Lehrtext des Concilium Constantinopolitanum; es drückt dort also den für die Kirche verbindlichen gemeinsamen Glauben der Konzilsväter aus, darum heißt es dort: „Pisteúomen“, „Homologoûmen“, „Prosdokômen“, und das haben anscheinend die GL-Verfasser übersetzt. In der Messe aber ist das Glaubensbekenntnis gleichsam der Ausweis, durch den sich jeder Gläubige für die Teilnahme an der eucharistischen Liturgie legitimiert; darum heißt es dort notwendigerweise „Credo – Ich glaube“, „Confiteor – Ich bekenne“ und „exspecto – ich erwarte“. Und darum heißt es in der griechischen Liturgie selbstverständlich ebenfalls „Pisteúo“, „homologô“ und „Prosdokô“.
Samstag, 31. Oktober 2020
Kein deutsches Kriegsgerät in Spannungsgebiete – wohl aber nach Aserbaidschan
«Die ... KSZE ... hat aufgrund des Konflikts in der Kaukasus-Region Nagorny-Karabach mit Beschluss vom 28. Februar 1992 alle Teilnehmerstaaten ... ersucht, ein Embargo über alle Waffen- und Munitionslieferungen gegen die beiden Konfliktparteien Armenien und Aserbaidschan zu verhängen.
Nachdem kein ausdrückliches Ausfuhrverbot ... besteht, erfolgt die Umsetzung des Waffenembargos auf der administrativen Ebene, das heißt es werden keine Ausfuhrgenehmigungen für Güter ... der Ausfuhrliste für Ausfuhren nach Armenien / nach Aserbaidschan erteilt.»
Soweit der deutsche Zoll. Armenien gegenüber gelingt das auch; Aserbaidschan gegenüber aber sieht es anders aus.
Für «Kriegswaffen aus Deutschland» bleibt die Türkei «bester Kunde»; und die Türkei unterstützt Aserbaidschan im Eroberungskrieg um Karabach ganz massiv. Sodann ist Deutschland «Israels größter Waffenlieferant»; und: «Etwa 60 Prozent der Rüstungsimporte Aserbaidschans stammen aus Israel.»
Daher ist im Karabach-Konflikt auch deutsches Kriegsgerät zu sehen, freilich nur auf Seiten Aserbaidschans.
Dienstag, 27. Oktober 2020
Die – nicht mehr ganz – neuen E&E-Hefte
Der damaligen Seuchengefahr fiel im März die feierliche Entkorkung der E&E-Hefte zum Opfer; nur an schon bekannte Interessenten konnten wir Hefte verschicken.
Nun aber lädt die neuerliche Quarantäne dazu ein, die Hefte in anderer Weise zur Verfügung zu stellen.
♦ Der heilige Joseph war „Zimmermann“, wie das Wort „Tekton“ üblicherweise übersetzt wird. Was ist eigentlich die Arbeit eines „Zimmermanns“ im Morgenland – ein solcher beschreibt es.
♦ «Vom Zeitgeist» handelt ein «polemischer Essay».
♦ Wie Juden einen Zaun um das Gesetz bauen, so bauen gewisse Theologen einen «Zaun um den Unglauben»; wir beobachten ihren Bau.
Wer Hefte zugeschickt bekommen möchte, der melde sich; wer sich mit dem Heft im Netz begnügt, kann sie am Rechner lesen oder selber auszudrucken. Herzliche Einladung dazu!
Montag, 26. Oktober 2020
Musiker und Zelebrant
Das weist mich auf die Frage, was den Unterschied zwischen wahrer Ars celebrandi und dem liturgischen Alltag ausmacht.
Montag, 12. Oktober 2020
Das jüdische Erbe im liturgischen Alltag
Während wir kürzlich, wieder einmal, reichlich Anlaß hatten, über katholisch.de zu nölen, war dort doch auch etwas Sinnvolles zu finden: «Wie Christen jüdisches Leben „normal“ sein lassen können», hieß es.
Der erste Satz – «Das Christentum verdankt sich der jüdischen Tradition» – ist zwar Unfug: das Christentum verdankt sich Christus. Aber der Hinweis «In jedem Sonntagsgottesdienst muss eine Lesung aus der jüdischen Bibel gelesen werden [gemeint ist der „ordentliche“ Usus] – oft wird sie „aus Zeitgründen“ weggelassen» und der Satz «Von Antisemitismus entsetzt sein und die alttestamentliche Lesung weglassen, die biblische Geschichte, den jüdischen Philosophen – das ist ein Widerspruch in sich» sind sehr berechtigt.
Schade nur, daß der Autor – es geht ja um den „ordentlichen“ Usus – nicht den Skandal der Leseordnung dieses Usus angesprochen hat – in kaum drei Wochen wird es uns ja wieder anspringen –, daß aus der Apokalypselesung des Festes (7, 2-14) die zwölf Stämme Israels (vv. 5-8) säuberlich herausgeschnitten sind, obwohl ohne ihre Aufzählung die Zahl „hundertvierundvierzigtausend“ (v. 4) kaum verständlich ist.
Siehe auch: Antijudaïsmus in der Liturgie?
Donnerstag, 8. Oktober 2020
Was ist Laizismus?
Laizismus, das ist die Trennung von Staat und Kirche, wird hierzulande oft geantwortet.
Französische Laizisten sehen das anders. Ich zitiere aus Une religion pour la République von Vincent Peillon (Seuil 2010, hier nach den Auszügen von Alain Escada):
«La laïcité française, son ancrage premier dans l’école, est l’effet d’un mouvement entamé en 1789, celui de la recherche permanente, incessante, obstinée de la religion qui pourra réaliser la Révolution comme promesse politique, morale, sociale, spirituelle. Il faut pour cela une religion universelle : ce sera la laïcité. Il lui faut aussi son temple ou son église : ce sera l’école. Enfin, il lui faut son nouveau clergé : ce seront les hussards noirs de la République. – Der französische Laizismus, seine erste Verankerung in der Schule, ist das Ergebnis einer 1789 begonnenen Bewegung, der ständigen, unablässigen, hartnäckigen Suche nach einer Religion, welche die Revolution als politisches, moralisches, soziales, spirituelles Versprechen wird verwirklichen können. Dafür nötig ist eine universelle Religion: das wird der Laizismus sein. Dafür nötig ist auch ihr Tempel oder ihre Kirche: das wird die Schule sein. Schließlich ist dafür nötig ihr neuer Klerus: das werden die schwarzen Husaren der Republik sein.»
«Toute l’opération consiste bien, avec la foi laïque, à changer la nature même de la religion, de Dieu, du Christ, et à terrasser définitivement l’Église – Das ganze Vorgehen besteht nun darin, mit dem laizistischen Glauben das Wesen selbst der Religion, Gottes und Christi zu verändern und die Kirche endgültig niederzuwerfen.»
Nun ist Vincent Peillon nicht irgendwer; er war von 2012 bis 2014 der französische Minister für Bildung, Jugend und Sport.
Wenn nun – so hat er es am 2. Oktober erklärt – Präsident Macron die Schulpflicht für alle vom Alter von drei Jahren an (entwicklungspsychologisch gesehen eine Monstrosität) einführen will und Schulunterricht daheim strikt begrenzen will, insbesondere auf gesundheitliche Notwendigkeiten, um gegen «die Separatismen» anzugehen, so verstehe ich die Sorgen, die das französischen Katholiken bereitet.
Mittwoch, 7. Oktober 2020
Abenteuer bei der Lektüre von katholisch.de
Der Regens des Limburger Priesterseminars hat eine Predigt gehalten, in der er auf breiter Front die Lehre der Kirche angreift. Eine Pfarrei hat sie auf Facebook veröffentlicht mit dem Kommentar «Eine beeindruckende Predigt», und katholisch.de berichtet darüber ohne (wen wundert es?) jedwede Distanz.
Nichts darin ist neu oder gar originell; dennoch seien ihr (zitiert aus katholisch.de) einige Bemerkungen gewidmet:
«.. Menschen, die nach einer Scheidung in einer neuen Beziehung leben: „Die beiden wollen nicht heiraten, sie wollen einen Segen. Ich darf nicht zu ihnen sagen: So ist es gut.“» – In der Tat nicht, denn, wenn es eine sexuelle Beziehung ist, so ist es nicht gut; das lehrt nicht nur die Kirche von heute, sondern schon das Evangelium (Matth. 5, 31 f.). («Es gibt hierzulande zwei Ansätze, gegen die Krise der Kirche anzugehen; der eine: Mehr Christus, die Welt ihm untergeordnet – der andere: Weniger Christus, mehr Welt», hatten wir einmal geschrieben.)
«.. eines gleichgeschlechtlichen Paares, das sich in einer Gemeinde in vielfältiger Weise engagiert: „Segnen darf ich sie nicht.“» – Doch, er darf sie segnen, nur eben die einzelnen Menschen, nicht ihre Verbindung.
«Theologen, die für das Weiheamt der Frau argumentieren, würden mundtot gemacht.» – Wir erleben es Tag für Tag, daß diese Leute keineswegs mundtot sind; aber die Kirche darf natürlich Theologen, die gegen ihre Lehre reden, in der Kirche nicht das Wort geben.
In einem anderen Artikel wird dagegen raisonniert, daß Laien nicht in der Messe predigen dürfen. Nun, ich etwa könnte zu einem Lesungstext sinnvolle Dinge sagen, sinnvollere als manche Priester und Diakone; nur: ich habe nicht die Autorität dazu, daß als offizielle Verkündigung zu tun. Diese Autorität haben Priester und Diakone durch die Weihe, sie kommt vom Herrn, könnte mir also auch nicht durch eine Sondererlaubnis von einem Amtsträger gegeben werden.
«Zudem kommt es nicht selten zu der kuriosen Situation, dass ein Priester sich bei seiner Homilie einer publizierten Predigtvorlage eines Laien bedienen kann, dieser Laie dieselbe Homilie aber nicht vortragen darf.» – Das ist nicht kurios: wenn der Priester den Text des Laien für gut befindet, ihn sich zu eigen macht und vorträgt, dann ist es nicht mehr der Text des Laien, sondern der des Priesters (das geistige Urheberrecht spielt hierfür keine Rolle).
Grundlegender noch:
«„Wir müssen überlegen, was die Predigt ist, was sie soll und welche Kompetenz man für sie benötigt – unabhängig davon, ob jemand ein Mann oder eine Frau ist.“ Auch Kardinal Reinhard Marx, Erzbischof von München und Freising, hat bereits laut darüber nachgedacht, ob nicht auch begabte Nichttheologen in der Heiligen Messe die Heilige Schrift auslegen könnten.» – In der Tat sollte das überlegt werden; die Antwort: die Predigt ist nicht nur die Mitteilung von Inhalten, sondern Teil der Liturgie. Die Liturgie aber steht unter einem Gesetz, das die Tradition der ganzen Kirche festhält: die liturgische Funktion der Predigt kommt nur dem Priester oder Diakon zu; in den orthodoxen Kirchen ist es ebenso.
Montag, 5. Oktober 2020
Ein Vergleich: Bergkarabach und Kosovo
Diese Länder zeigen deutliche Übereinstimmungen:
• Beide Länder waren autonomer Teil eines Nachbarlandes, Bergkarabach von Aserbaidschan, das Kosovo von Serbien.
• In beiden Ländern gehört die Bevölkerungsmehrheit zu einer anderen Nation: in Bergkarabach sind es Armenier, im Kosovo Albaner.
• Über Jahrzehnte waren die Gegensätze unter Kontrolle dadurch, daß die Staaten einem größeren Bundesstaat angehörten, Aserbaidschan zu Sowjet-Union, Serbien zu Jugoslawien.
• Bei deren Zusammenbruch gab Gewalttaten von Seiten des Staatsvolks gegen die örtliche Bevölkerungsmehrheit.
• Daraufhin erklärten sich beide Länder für unabhängig, 1991 Bergkarabach, 1992 das Kosovo.
• Es kam zum Krieg, beide Seiten erhielten militärische Hilfe von außen.
• Schließlich wurden beide Länder unabhängig.
Damit aber sind die Übereinstimmungen erschöpft; die Unterschiede sind groß:
• Militärische Hilfe erhielt Bergkarabach nur vom kleinen Nachbarland Armenien, das Kosovo aber von der NATO.
• Die Unabhängigkeit Bergkarabachs wird völkerrechtlich bisher nur von Armenien anerkannt; die des Kosovo aber, zunächst nur von Albanien anerkannt, wird, seit es 2008 noch einmal seine Unabhängigkeit erklärt hat, von den meisten westlichen Staaten anerkannt.
Ebenso unterschiedlich ist die Vorgeschichte:
• Außerhalb der Zeiten der Besetzung durch Perser, Araber, Seldschuken waren Bergkarabach und angrenzende Gebiete immer von Armeniern regiert, bis schließlich ganz Transkaukasien zum russischen Reich kam. Das Kosovo demgegenüber war nie albanisch regiert, sondern mal serbisch, mal byzantinisch und auch bulgarisch, bis es zum Osmanenreich kam.
• Die Bevölkerung in Bergkarabach und angrenzenden Gebieten war immer ganz überwiegend armenisch, während im Kosovo sich erst im XIX. oder XX. Jahrhundert eine albanische Mehrheit ergab, doch eine große serbische Minderheit bestehen blieb.
• Beiderseitige Gewalttätigkeiten in der Zeit des Niedergangs und der Auflösung Jugoslawiens und der Sowjet-Union gab es auch im Kosovo (wobei Thema in der westlichen Presse vor allem die serbischen waren), Pogrome und Massaker großen Ausmaßes aber sind nur aus Karabach und Aserbaidschan gegen Armenier bekannt: so kam es 1990 zu einem Pogrom in Baku, 1992 in Bergkarabach zum Massaker von Chodschali und zu dem von Maraga.
Die Unabhängigkeit Bergkarabachs ist nicht weniger begründet, die Unabhängigkeitserklärung nicht weniger gerechtfertigt als die des Kosovo. Aber was folgte, ist sehr unterschiedlich: Das Eingreifen der NATO (mit einem nicht zu rechtfertigenden Bombenkrieg gegen Serbien) und diplomatische Anerkennung durch die meisten westlichen Länder: das hat dem Kosovo Sicherheit gegeben; Bergkarabach dagegen, nur von Armenien anerkannt, ist ohne Schutz einem von der Türkei unterstützten Eroberungskrieg ausgesetzt.
«Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan hatte dem Nachbarland aber zuvor jede Art von Unterstützung zugesichert.» – «In einem offenen Brief an den türkischen Präsidenten schrieb der aserbaidschanische Staatschef, die offenen Worte Erdoğans hätten gezeigt, dass Aserbaidschan „nicht allein steht mit seinem gerechten Anliegen“, die eroberten Gebiete in und um Berg-Karabach herum zurückzugewinnen.» – «US-Präsident Donald Trump, Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und Kremlchef Wladimir Putin hatten gemeinsam eine sofortige Waffenruhe und einen Dialog gefordert. Während sich Armenien offen dafür zeigte, lehnte Aserbaidschan ab. Aliyew forderte die Rückgabe Berg-Karabachs ...» (SZ)
Nachtrag: siehe auch: Aschot L. Manutscharjan: Der Berg-Karabach-Konflikt nach der Unabhängigkeit des Kosovo
Mittwoch, 30. September 2020
Noch einmal: Krieg gegen Karabach
Aber vieles spricht dafür, daß es eine Angriffskrieg ist, den Aserbaidschan zusammen mit der Türkei vorbereitet hat: «Allerdings hatte sich die erneute Eskalation auch durch türkisches Zutun angekündigt: Laut mehreren Berichten wurden zuletzt Hunderte türkische Kämpfer von Libyen und Syrien nach Aserbaidschan verlegt», lese ich in der Zeitung; und die Iraqi Christian Foundation weiß von Tausenden von Dschihadisten, Reuters hat von Söldnern aus Syrien erfahren.
«Erdoğan sagt, Armenien müsse sich zurückziehen aus aserischen Ländern», so Reuters – diese aserischen Länder sind armenisch besiedelte und in der Zeit vor der russischen Eroberung von armenischen Fürsten regierte Länder, die von der Sowjet-Union Aserbaidschan zugeschlagen wurden, aber als Autonomes Gebiet. Erst das unabhängige Aserbaidschan hat nach der Auflösung der Sowjet-Union diese Autonomie nicht mehr respektiert; es kam zu antiarmenischen Pogromen und darauf zur militärisch erkämpften Unabhängigkeit.
Dienstag, 29. September 2020
Krieg gegen Karabach
Heute versucht Aserbaidschan, Karabach militärisch zurückzuerobern. Rußland bemüht sich um Vermittlung, der UNO-Generalsekretär ruft zum sofortigen Ende der Kämpfe auf – sonst nichts.
Nein, ein Bombenkrieg, wie er damals gegen Serbien geführt wurde, um das Kosovo den Albanern zu überlassen, wäre unverantwortlich – so wie er damals unverantwortlich war. Aber dem reichen Ölland Aserbaidschan militärisch freie Bahn zu geben, Friedensbemühungen nur Rußland und dem nicht sehr mächtigen UNO-Generalsekretär zu überlassen, ist auch nicht annehmbar.
Jedenfalls verbindet das Kosovo sehr viel mehr mit Serbien als Karabach mit Aserbaidschan, dem es nur in der Sowjetzeit zugeschlagen worden war.
Montag, 28. September 2020
Als die Kirche im falschen „Paradigma“ gelandet war
Im „konservativen Paradigma“ sei der Sinn des Lebens nicht das Glück; überindividuelle „Logiken“ wie der Tradition, dem Staat, der Nation, der Familie, aber auch der Kirche werde der Vorrang zugesprochen, an sie müsse sich der Einzelne anpassen. Opferbreitschaft, Ehre, Mut, Gehorsam, Treue seien die höheren Werte.
Dieser konservativen Kultur gegenüber habe dann eine progressive die Oberhand gewonnen, ein „moralischer Individualismus“, eine „Kultur des Bedürfnisses“, die sich nur schwer einer Norm unterwerfe.
Am härteten getroffen habe dieser Umschwung die traditionelle Familie und die traditionellen Kirchen.
Soziologisch ist die Darlegung sicher berechtigt – und das ist schlimm.
Sicher sind mit dem „konservativen Paradigma“ Werte verbunden – Opferbreitschaft, Ehre, Mut, Gehorsam, Treue –, die auch der christliche Glaube hochschätzt; aber es sind für den Christen keine Werte um ihrer selbst willen. Umgekehrt: daß, ganz im Gegensatz zu diesem „Paradigma“, «das letzte Ziel des menschlichen Lebens das Glücklichsein oder die Seligkeit» ist, lehrt, ganz in der eudämonistischen Tradition des Sokrates, der heilige Thomas (S. Th. Ia IIæ q. 90 a. 2). Gemeinschaften wie Familie und Kirche haben für den Christen hohen Wert, aber sie sind nicht Selbstzweck. Schon in den Zehn Geboten steht, «ehre deinen Vater und deine Mutter», und der Herr selber hat den Mangel an Beistand für sie seitens der Schriftgelehrten gerügt (Marc. 11-13); aber es geht hierbei um die Menschen selbst, nicht um eine Gemeinschaft als Kollektiv. Andererseits ist schon durch Ezechiel (18, 2-4) klargestellt, daß Verantwortung jeder einzelne trägt, nicht etwa die Familie als Kollektiv; und der Herr selber hat gesagt, daß Ihm nachzufolgen den Vorrang hat gegenüber der Familie (Luc. 14, 26), daß der Glaube an Ihn auch Familien spalten werde (Matth. 10, 35-37; Luc. 12, 53). Und Heilige wie Franziskus und Thomas von Aquin haben sich ihrer Familie entgegengestellt, um ihrer Berufung zu folgen.
Noch als Schüler in der zweiten Hälfte des XX. Jahrhunderts mußte ich manchmal hören, man müsse sich der Gemeinschaft unterordnen; und dieser Satz hat mich geärgert. Weder jenes „konservative Paradigma“ noch der normenlose progressive „moralische Individualismus“ (der heute, in Zeiten der politischen Korrektheit, in nie gekannter Weise von Normen überwuchert ist) entsprechen dem christlichen Glauben; letztlich sind sie zwei – wenn auch gegensätzliche – Varianten des Modernismus. Aber es stimmt, daß der Abstand des Christentums von der konservativen Variante, wie sie sich seit dem XIX. Jahrhundert entwickelt hatte, oft nicht sichtbar war und so vor der Welt das Profil des Glaubens verwischt erschien – was das Überhandnehmen der progressiven Variante begünstigt hat.
Freitag, 25. September 2020
Kultur – Rasse – Intelligenzmessung
Samstag, 19. September 2020
Nein, darüber bin ich nicht glücklich
Im Jahre 2000 Sir Steven Runciman: Manchmal – sozusagen – fühle ich mich sehr enttäuscht von den anderen Kirchen des Westens. Doch bin ich glücklich darüber, zu denken, daß in den nächsten 100 Jahren die Orthodoxie die einzige existierende historische Kirche sein wird.
Im Jahre 2020 eine Statistik: Wer glaubt noch (wirklich) an Gott?
Abtreibung
Worte des US-amerikanischen Obersten Gerichtshofs: «Wesen einer unteren Ordnung, um so viel tiefer stehend, daß sie keine Rechte hätten, die der ... Mensch zu respektieren hätte.» Nein, damit waren nicht ungeborene Kinder gemeint; doch setzte man hier «ungeborene Kinder» ein, so gäbe das ebendie Denkweise wieder, die diesen Gerichtshof ein gutes Jahrhundert später dazu veranlasste (Roe v. Wade), dem ungeborenen Kind den Titel einer «Person» zu verweigern.
Dieses Positum als Zeichen der Solidarität mit dem heutigen Marsch für das Leben, an dem ich der Corona-Gefährdung wegen physisch nicht teilnehme.
Nachtrag zur «Öffnung zur Welt»
Mit diesem Positum kritisiere ich natürlich nicht das II. Vaticanum, ebensowenig aber pauschal die damit verbundenen Reformen.
Reformen waren in den sechziger Jahren dringend notwendig. Bis dahin galt noch der Index librorum prohibitorum, der einen Großteil der neueren philosophischen Literatur – selbst solche von gläubigen katholischen Denkern wie René Descartes – zu lesen Katholiken strikt untersagte, so daß sie, wenn sie nicht eine Sondererlaubnis ihres Beichtvaters hatten, im Gespräch mit Nichtkatholiken schwerlich mitreden konnten, ganz im Kontrast zu ihren Aufgaben im Laienapostolat, in der katholischen Aktion, wie sie von den Päpsten seit Leo XIII. gewollt und gefördert worden waren.
Bis dahin galt noch das Dekret der Propaganda Fide (nicht des Papstes!) von 1729, das jede Communicatio in sacris, selbst jede Gebetsgemeinschaft zwischen katholischen und orthodoxen Christen strikt untersagte, im Kontrast zu dem, was das Tridentinum gewollt hatte.
Reformen waren dringend notwendig. Nur: außer der notwendigen Reformen gab es auch andere, darunter solche, die den Intentionen der Konzilstexte direkt zuwiderliefen, wie wir es für die Reform der Liturgie aufgezeigt haben. Und das Thema «Öffnung zur Welt» steht besonders für unglückliche Reformen.
Donnerstag, 17. September 2020
Öffnung zur Welt
«Erneuerung nach innen – Öffnung zur Welt» betitelt katholisch.de („weltkirche.de" ist weltkirche.katholisch.de) seine Seite über das II. Vaticanum.
Schon einmal zuvor hat es in der Kirchengeschichte eine Öffnung zur Welt gegeben: im IV. Jahrhundert die „Konstantinische Wende“. Sie ging damals vom Staat aus, vom Kaiser. Sie gab der Kirche Freiheit und ermöglichte ihr außerordentliche geistliche Entfaltung – die folgenden gut hundert Jahre waren die große Zeit der Kirchenväter. Doch sie hatte auch andere Folgen: Mächtige des Staates begannen sich in das kirchliche Leben einzumischen, kirchliche Stellungen wurden auch attraktiv für Menschen mit mehr weltlichen Interessen; so kam es dann auch zu Verweltlichung – der allerdings das zur gleichen Zeit entstandene Mönchtum entgegentrat.
Die Öffnung zur Welt in der Folge des Konzils geschah unter ungünstigeren geistesgeschichtlichen Umständen. So konnte es durch sie zu keiner ähnlichen geistlichen Entfaltung kommen; doch ungünstige Folgen gab es wiederum.
So könnte die „Konstantinische Wende“ als das große Vorbild gelten für die Öffnung zur Welt des XX. Jahrhunderts. Doch sonderbar: ebendieses Vorbild wurde nicht gewollt. Auf einer anderen Seite von katholisch.de – «Konzil, Reich Gottes und Kirche der Armen» – wird Papst Johannes XXIII., der das II. Vaticanum einberufen hat, der Ausspruch zugeschrieben, «der imperiale Staub der Vergangenheit der Konstantinischen Ära müsse weggewischt werden. ... zugunsten des „Aggiornamentos“, des „Heute-Werdens“, der Kirche.» Aus einem Vortrag wird zitiert, «dass sich mit der Konstantischen Wende im Jahre 313 aus einer prophetisch-messianischen Christenheit ein imperial-kolonisierendes Christentum entwickelt hätte, das bis in die Gegenwart die Kirche geprägt hätte. Mit dem Konzil sei allerdings eine Rückbesinnung auf die Bibel, auf das Wort Gottes eingeleitet worden.»
Was nun: Rückbesinnung oder Aggiornamento, wie es die Kirche bei der „Konstantinischen Wende“ schon einmal betrieben hat – damals freilich sehr viel behutsamer, mit sehr viel mehr Rückbindung an das Wort Gottes.
Zu empfehlen: Roberto Pertici: IL POST-CONCILIO E I “GRANDI BALZI IN AVANTI” DELLA MODERNITÀ (in vier Sprachen)
Siehe auch: Nachtrag
Dienstag, 15. September 2020
Geistlicher Reichtum im Kirchenkonzert
Samstag, 12. September 2020
Fest des Namens Mariæ
Freitag, 11. September 2020
Rassismus und Ultra-Rassismus
Von Angehörigen und Freunden dunklerer Hautfarbe hierzulande zu hören, daß sie rassistische Anfeindungen und Pöbeleien erleben, ist schmerzlich.
Zu einem drängenden Thema aber ist Rassismus jetzt dadurch geworden, daß sich besonders in den USA rassistische Gewalt – von beiden Seiten (obwohl die politische Korrektheit schwarzen Rassismus nicht war haben will) – aufgeschaukelt hat. Von welcher Seite her es als schlimmer erscheint, hängt von der politischen Ausrichtung der jeweiligen Quelle ab. Dazu Stellung zu nehmen ist ein Navigieren zwischen Skylla – der Verharmlosung der offenbar dort sehr verbreiteten rassistischen Gewalt und US-amerikanischen Polizeigewalt – und Charybdis (politisch korrekter Instrumentalisierung).
(Jedenfalls ist die Gewalt der einen Seite nicht durch die der anderen zu entschuldigen. Nichtsdestoweniger aber ist die Frage moralisch bedeutsam, von wem die Gewalt anfangs ausging; denn wenn aus einer Gruppe heraus Gewalt gegen eine andere angewandt wird, so erzeugt das regelmäßig Gegengewalt, für die der, der begonnen hat, mitverantwortlich ist.)
Interessante Beiträge zu diesem Thema waren in letzter Zeit in Blöggen erschienen: „Wie man Hashtags nicht anwendet“, „Statuen stürzen?“, „Was ist Rassismus?“ – und auch zwischen ihnen gibt es Reibungen.
Wir haben nun uns bemüht, darzulegen, was Rassismus eigentlich ist, ohne dabei an Skylla oder Charybdis zu stoßen.
Montag, 7. September 2020
Die Cantorianer
Dienstag, 1. September 2020
Covidzeitliche Liturgie
Und man kann nur hoffen und beten, daß nicht irgendwelche Katholiken in der Zeit der aufgehobenen Sonntagspflicht sich die Meßteilnahme ganz abgewöhnen.
Zur Kommunionausteilung wird «Der Leib des Herrn» wie ein zweites «Sehet das Lamm ...» an die Allgemeinheit vorausgeschickt; nichtsdestoweniger tragen viele Priester bei der Austeilung eine Atemschutzmaske – in Ordnung.
Außerdem desinfiziert sich der Priester vor der Austeilung die Hände; und da setzt meine Frage an: Warum nicht schon bei der Handwaschung am Ende der Opferung? – da paßte es vom Ritus her gut hin, und es bestünde noch keine Gefahr, daß dabei Partikel vom Leib des Herrn verwischt werden (wenn ich die Handkommunion empfangen habe, schaue ich auf meine Hand und finde dort nicht oft, aber doch immer wieder Partikel).
Donnerstag, 27. August 2020
Nachricht und Wirklichkeit
Montag, 24. August 2020
.. damit nichts zugrundegehe
Dank an Kaplan M.R.
Zwei Kapläne waren es, die das geistliche Leben in unserer Stadt bereichert haben und kurz nacheinander uns nun verlassen haben. Nun hoffe ich auf die neuen Priester am Ort – eine große Aufgabe ist ihnen überlassen.
Dienstag, 18. August 2020
Einer Äbtissin droht das Gefängnis
Montag, 17. August 2020
Urlaub im Ausland
Jesus begab sich mit seinen Jüngern (Mtth. 15, 23) nach Phönizien (dem heutigen Libanon), in heidnisches Gebiet also, und wollte niemanden kennenlernen (Mc. 7, 24), also nicht predigen, in keiner Weise wirken, was ihm freilich nicht ganz gelang.
Wozu diese Reise? Ein Grund, der etwas mit der Berufung Jesu zu tun hätte, läßt sich nicht erkennen.
Es bleibt nur die einfache Antwort: es war eine Urlaubsreise ins Ausland – auch der Herr und seine Jünger brauchten gelegentliche Entspannung.
Harsch erscheint in dieser Perikope sein Umgang mit der Kanaanäerin. Der Grund dafür ist nicht einfach der, daß sie zu einem anderen Volk gehört, sondern, daß sie zu den Heiden gehört, die Götzendienst betreiben. Das Verbot des Götzendienstes steht am Anfang der Zehn Gebote (Ex. 20, 3-6; Deut. 5, 7-10), ist aber keineswegs nur Gebot für Israel, das Bundesvolk, sondern wird von allen Völkern eingefordert; über vier Kapitel hin (13-16) stellt das Buch der Weisheit dar, wie sehr der Götzendienst der Heiden zu verurteilen ist. Doch als die Kanaanäerin demütig ihren Glauben gezeigt hat, erhält sie vom Herrn Anerkennung und Erhörung.
Dank an Kaplan M.M.
Freitag, 14. August 2020
Ein wirklicher Feiertag
Am Sonntag ist in der Propstei zu festtäglicher Zeit, um 10 Uhr, die Festmesse (wem haben wir zu danken: dem polnischen Kaplan oder dem neuen Propst? – doch sicherlich beiden). In der Kirche im Gründerzeitviertel gibt es eine Abendmesse mit Kräuterweihe (allerdings: «gestaltet vom Frauenkreis»). Nur ist denen, die sonst gewohnt sind, zu dieser Zeit an der sonntäglichen Vorabendmesse teilzunehmen, ist zu wünschen, daß sie vorher bemerken, daß sie die heute nicht finden werden.
Donnerstag, 6. August 2020
Die Verbindlichkeit der Form der Sakramente
Fest der Verklärung Christi
Mittwoch, 5. August 2020
Wohltuendes aus Messen des außerordentlichen wie des ordentlichen Ritus
Freitag, 31. Juli 2020
Das Lob des Herrn für den ungerechten Verwalter
Der Prediger weist darauf hin – ohne dem zuzustimmen –, daß für den 8. Vers auch eine andere Übersetzung und ein anderes Verständnis vorgeschlagen worden ist.
Dem sei hier nachgegangen.
Donnerstag, 16. Juli 2020
Der Weiheritus: Papst Pius XII. und das Florentinum
Gegen Mons. Viganòs Angriff zeigt Kardinal Brandmüller auf, daß die Konzilsdekrete aus ihrer Zeit, nicht aus der unseren heraus zu begreifen sind und so recht verstanden keine Irrlehren sind. Hier ist ihm völlig zuzustimmen.
Gegenüber Mons. Schneider stellt er im einen Fall klar, daß das betreffende Dekret die Irrlehre, die Mons. Schneider darin sieht, gar nicht enthält. Im anderen Fall aber bedarf Kardinal Brandmüllers Argumentation näherer Erörterung.
Dienstag, 14. Juli 2020
Welch ein Fest!
Freitag, 10. Juli 2020
Verkehrte Welt
Unser Chronist stellt es dar.
Mittwoch, 8. Juli 2020
Das Elend der Diskretion
Aktualisierung:
«Und nach vierzehn Jahren ließ ein anderer Papst, Paul VI., ihn [P. Kentenich], als sei er rehabilitiert, nach Schönstatt zurückkehren», hatten wir geschrieben – ein Irrtum, den Alexandra v. Teuffenbach jetzt anhand eines Briefes des seinerzeitigen Präfekten der Glaubenskongregation, Kardinal Ratzingers, aufklären konnte: als P. Kentenich ohne Erlaubnis aus den USA nach Deutschland zurückgekehrt war, war ihm von der Glaubenskongregation zwar erlaubt worden, als Diözesanpriester im Lande zu bleiben, aber weiterhin untersagt worden, ins Priesterinstitut von Schönstatt zurückzukehren oder wieder die Leitung des Schönstattwerks zu übernehmen.
Sonntag, 28. Juni 2020
Heilige gegen den Geist unserer Zeit
Doch würde man diesen Heiligen nicht gerecht, wollte man sie darauf reduzieren, Heilige der Nächstenliebe zu sein: beide waren zunächst geistliche Männer und Missionare.
Heute abend aber beginnt nach gregorianischem Kalender das Fest der heiligen Apostel Petrus und Paulus.
Ihrem Rang im Neuen Testament gemäß ist ihre Heiligkeit in der Kirche unumstritten. Jenem Zeitgeist allerdings entsprechen Petrus und die Apostel nicht – sie erklärten, als einige Witwen in der Kirche zu kurz kamen (Act. 6, 2-4): «Es ist nicht angemessen, daß wir das Wort Gottes beiseite lassen und bei den Tischen dienen. ... wir aber werden dem Gebet und dem Dienst des Wortes gewidmet bleiben.»
Doch – und der fromme Zeitgeist jedenfalls schätzt auch das hoch – sie engagierten sich ganz inmitten der Gemeinde.
• Ein Lied zu Ehren des heiligen Petrus •
Nach julianischem Kalender aber beginnt heute abend das Fest der Translation des heiligen Feofan Zatwornik, Theophanes’ des Klausners.
Feofan, 1815 geboren, wurde Mönch, wurde Priester, wurde mit 44 Jahren Bischof. Sieben Jahre später bat er um die Erlaubnis, seiner Diözese zu entsagen und sich in ein Kloster zurückzuziehen. Das wurde ihm gewährt; er wurde zum Oberen des Klosters ernannt, aber, wiederum auf seine Bitte hin, schon nach drei Monaten auch von dieser Aufgabe befreit. In den ersten Jahren nahm er noch ein wenig am Klosterleben teil, er überlegte zwischendurch auch, ins Bischofsamt zurückzukehren – 1872 wurde ihm sogar die Diözese Moskau angetragen –, doch ein Jahr später entschloß er sich, sich völlig in seine Klause zurückzuziehen. Fortan weihte er sich ganz dem Herrn, der Gemeinschaft mit ihm; er entzog sich völlig jeder menschlichen Gemeinschaft. In seiner Zelle errichtete er eine kleine Kapelle, die er mit dem Titel der Theophanie weihte; dort zelebrierte er zunächst sonn- und feiertags, bald dann täglich alleine die Göttliche Liturgie. Dort starb er schließlich, längst krank und ganz alleine, mit 88 Jahren am Fest der Theophanie.
Ein Heiliger, der sich jeder menschlichen Gemeinschaft entzog, der immer allein blieb, nur für sich allein die Messe zelebrierte.
Manchem modernen Menschen mag da der Vorwurf in den Sinn kommen, er habe sich nur von anderen versorgen lassen – natürlich erhielt er sein Essen von außen –, ohne selber etwas für die Gemeinschaft zu tun. Kein Vorwurf könnte abwegiger sein – er tat sehr viel für andere: er betete und er schrieb. Er schrieb geistliche Bücher, übersetzte aus dem Griechischen, so etwa die Philokalie, und verfaßte eigene Werke; einen bedeutenden Satz daraus haben wir anderswo zitiert. Auch wurde er Mitglied eines Wohltätigkeitsvereins, der Bruderschaft des heiligen Fürsten Wladimir, gegründet, um «notleidenden russischen Staatsbürgern jeder christlichen Konfession und orthodoxen Christen jeder Nationalität zu helfen». Nur für sich selbst verzichtete er auf alle menschliche Gemeinschaft.
Feofan Zatwornik wurde von der russisch-orthodoxen Kirche heiliggesprochen. Ganz privat aber darf wohl auch ein Katholik beten: «Sancte Theophanes recluse, ora pro nobis!»
• Théophane le Reclus •
• Феофан Затворник •
Dienstag, 23. Juni 2020
Klare Worte von der Kanzel
Freitag, 19. Juni 2020
Dogmenenthobenheit einer Dogmatikerin
Was heute an sehr vielen Protestanten in der Tat wertzuschätzen ist, ist ihre Abkehr von manchen Lehren Luthers wie besonders von seinem «sola fide», wenn es leider auch rein formelhaft oft noch von ihnen im Mund geführt wird.
Samstag, 6. Juni 2020
Was von uns von Le Barroux bleibt
Darauf weisen wir gerne hin – und dabei sei auch auf eine schöne liturgische Besonderheit aufmerksam gemacht (um 17.30 beginnt die Vesper mit dem Responsorium prolixum Benedictus).
Freitag, 5. Juni 2020
Gute und schlechte Lehren aus der Zeit der Verbote
Nun ist es Zeit, diese Erfahrungen auszuwerten.
Samstag, 23. Mai 2020
Kirche und katholische Universitätstheologie (II.)
Bemerkenswerte Meinungen äußert der Professor im Interview: «Auch viele meiner Kolleginnen und Kollegen, die da diese Stellen deuten, sagen, dass der Katechismus geändert werden kann. Das ist keine große Sache. Das hat Papst Franziskus vor kurzem auch gemacht, als er den Passus über die Todesstrafe geändert hat ... Aber das geht.
Schlechte Traditionen zu beenden und eine andere Lehre zu bringen, das gibt es in der katholischen Kirche durchaus. Wir sehen das an der Einstellung gegenüber dem Judentum. Und so kann man in gleicher Weise auch die Einstellungen und Lehren der katholischen Kirche über ... ändern.»
Es ist eine Verwirrung von Begriffen: Freilich kann man den Katechismus ändern, der nur eine Zusammenfassung wichtig erscheinender Lehren ist (und kein unfehlbares Lehrdokument); aber die Lehre der Kirche kann (wohl schärfer gefaßt, wohl weiter ausgeführt, aber) nicht geändert werden.
«Schlechte Traditionen zu beenden und eine andere Lehre zu bringen»: es kann schlechte Traditionen in der Kirche geben, es können falsche oder unsichere Lehren auf Kanzeln der Kirche verkündet werden; aber die Tradition der Kirche im eigentlichen Sinn ist Kern des christlichen Glaubens, ist niemals schlecht. Er bringt die «Einstellung gegenüber dem Judentum» als Beispiel: in der Tat gibt es üble Worte von Kirchenvätern über die Juden, es gab auch üble Konzilsvorschriften ihnen gegenüber; aber waren Ausfälle, eine häßliche Scharte in der Tradition, aber keineswegs die Tradition – die umfaßt klare Aussagen für die Religionsfreiheit der Juden.
Da aber nun der Professor «eine andere Lehre» einführen will, wird ihm natürlich die Frage gestellt: «Und wer ist die Instanz, die entscheidet, was richtig ist?» Seine Antwort:
«Da könnten Sie jetzt auf das Lehramt hinauskommen. Aber gerade diese Instanz möchte ich nicht ins Spiel bringen. Vielmehr sehe ich zwei große Säulen, wie man Bibel richtig interpretieren kann. Das eine ist der Kontext ... Die andere Säule ist die Auslegungsgemeinschaft. Davon gibt es ganz viele. Das ist jetzt nicht nur die römisch-katholische Kirche, das ist eigentlich jede Pfarrgemeinde, jeder Bibelkreis oder, wenn ich mit meinen Studierenden im Seminar sitze, sind wir auch eine Auslegungsgemeinschaft. Und dann muss jeder seine Bibel-Lektüre, seine Bibelauslegung in diese Auslegungsgemeinschaft hineingeben. Und im Gespräch wird sich dann herauskristallisieren, ob diese Auslegung trägt oder ob sie vielleicht einseitig, abseitig ist, ob man sie vielleicht mit anderen Bibeltexten noch einmal relativieren muss.»
Das erste, der Kontext: klar. Das zweite aber hat es in sich: eine freie «Auslegungsgemeinschaft», an der die Hierarchie der Kirche keinen maßgeblichen Anteil hat, Bindung an den Glauben der Kirche nicht vorausgesetzt ist. Und es ist eine rein zeitgenössische Runde, die da die Vollmacht haben soll, «eine andere Lehre» einzuführen: die Tradition der Kirche wird nicht mehr erwähnt – es klingt deutlich nach sola scriptura –; aber der Professor, «wenn ich mit meinen Studierenden im Seminar sitze», gehört natürlich dazu. Ohne Tradition, ohne Lehramt hat diese «Auslegungsgemeinschaft» völlig freie Hand. Er «habe so einen kleinen Universalschlüssel für die Auslegung der Bibel, und er steht in Levitikus 18,5 ziemlich versteckt. Da heißt es: Der Mensch, der danach handelt, nämlich nach der Weisung Gottes nach der Thora, wird leben. Das heißt, ein gelingendes Leben ist das Ziel. Wenn aber eine Auslegung der Bibel zum Leben nicht mehr befähigt, sondern vor dem Leben Angst macht, dann ist, glaube ich, die Auslegung falsch.» In der Tat ist ein gelingendes Leben das Ziel, ein Leben, das zum Heil führt. Doch wenn jemandem etwas «vor dem Leben Angst macht», so kann das auch statt in der Auslegung in der Person liegen: der reiche Jüngling des Evangeliums wurde traurig durch die recht verstandenen Worte des Herrn (Matth. 19, 16-22).
Was solche Neuschöpfungen von Lehren vor Willkür, vor Unterwerfung gegenüber dem Zeitgeist und aktueller Befindlichkeit schützen könnte, sehe ich nicht.
Und bei Änderungen der Lehre geht es ihm nicht um Feinheiten, sondern «auch zum Beispiel über Fragen der Frauenordination». Das Wesentliche jeder Sakramentsspendung ist das Wirken des Herrn, das der Kirche zugesagt ist, wenn sie Sakramente nach Seiner Ordnung spendet. Könnte etwa seine «Auslegungsgemeinschaft» darüber sicher bestimmen?
Vor etwa fünfhundert Jahren gab es das schon einmal, daß eine freie «Auslegungsgemeinschaft», Theologie-Professoren an der Spitze, die andere Lehren einführten ohne Bindung an die Hierarchie, ohne Bindung an die Tradition der Kirche.
P.S.
1.
Welcher theologischer Sorgfalt es bedarf, eine global formulierte Lehre der Kirche schärfer, differenzierter zu fassen, zeigt etwa der Brief des Heiligen Offiziums an den Erzbischof von Boston vom 8. Aug. 1949, der die Lehren der Feeneyisten zurückweist (Denzinger – Schönmetzer (Ed. XXXII) nr. 3866-3873).
2.
Auf die Frage «Die katholische Kirche hat lange gebraucht, um zu der Erkenntnis zu kommen, dass dort [im Schöpfungsbericht] keine naturwissenschaftliche Aussage getroffen wird ... Warum hat das so lange gedauert?» antwortet der Professor: «Das ist ein Geheimnis der Kirchengeschichte. Es hat tatsächlich bis Anfang der 1990er-Jahre gedauert, als der spätere heiliggesprochene Papst Johannes Paul II. den Fall Galilei für die Kirche gelöst hat ...» Doch schon Pius XII. hat mit den Enzykliken Divino Afflante Spiritu von 1943 und Humani Generis von 1950 die katholische Theologie vom überspannten Biblizismus der Bibelkommission Pius’ X. gelöst.
Mittwoch, 13. Mai 2020
Warum ich mich nicht gegen die aktuellen Einschränkungen von Gottesdiensten wende
Wirklich: die Einschränkungen und die zeitweiligen Verbote der Gottesdienste tun weh. Und natürlich habe ich alle Möglichkeiten genutzt, zu einer Sonntagsmesse zu gelangen, auch einmal etwas im Schatten.
Aber diesen Appell werde ich nicht unterschreiben.
Vor gut hundert Jahren bestand in den Zeiten der Spanischen Grippe der Bischof von Zamora gegen den Willen der staatlichen Behörden darauf, der Seuche Bittgottesdiensten und Prozessionen entgegenzusetzen. Daraufhin hatte Zamora einen größeren Anteil an Todesopfern zu verzeichnen als jede andere spanische Stadt, darunter zwei der drei Seherkinder von Fátima.
In Schweden waren die Einschränkungen wegen Covid-19 viel geringer als in anderen europäischen Ländern; für Gottesdienste gab es lange Zeit keine wirklichen Beschränkungen. Die Folge: die syrisch-orthodoxe Kirche in Schweden zählt weit über hundert Todesopfer.
Auch ich hätte etwas andere Schutzmaßnahmen für besser gehalten, mehr vorgeschriebenen Mundschutz, mehr Produktion von Schutzmasken, weniger Kontaktbeschränkungen. Aber das sind Détailfragen.
Wer auf Gottes Schutz zählen will, darf nicht deshalb die Schutzmaßnahmen beiseite lassen, die Seine Schöpfung bietet.
P.S.
Das CIVITAS-Institut hat es anders gesehen als ich (in Frankreich ist freilich das Confinement viel strenger als hierzulande) – und Erfolg vorm Staatgerichtshof gehabt:
« Communiqué du Conseil d’Etat
« Le juge des référés du Conseil d’État ordonne au Gouvernement de lever l’interdiction générale et absolue de réunion dans les lieux de culte et d’édicter à sa place des mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires et appropriées en ce début de « déconfinement ».
« Saisi par plusieurs associations et requérants individuels, le juge des référés du Conseil d’État rappelle que la liberté de culte, qui est une liberté fondamentale, comporte également parmi ses composantes essentielles le droit de participer collectivement à des cérémonies, en particulier dans les lieux de culte. Elle doit, cependant, être conciliée avec l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.
« Dans l’ordonnance rendue ce jour, le juge des référés relève que des mesures d’encadrement moins strictes que l’interdiction de tout rassemblement dans les lieux de culte prévue par le décret du 11 mai 2020 sont possibles, notamment compte tenu de la tolérance des rassemblements de moins de 10 personnes dans d’autres lieux ouverts au public dans le même décret.
« Il juge donc que l’interdiction générale et absolue présente un caractère disproportionné au regard de l’objectif de préservation de la santé publique et constitue ainsi, eu égard au caractère essentiel de cette composante de la liberté de culte, une atteinte grave et manifestement illégale à cette dernière.
« En conséquence, il enjoint au Premier ministre de modifier, dans un délai de huit jours, le décret du 11 mai 2020 en prenant les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu applicables en ce début de « déconfinement », pour encadrer les rassemblements et réunions dans les établissements de culte. »
Samstag, 9. Mai 2020
Kirche und katholische Universitätstheologie
«Dieselbe heilige Mutter Kirche hält fest und lehrt, daß Gott, der Ursprung und das Ziel aller Dinge, durch das natürliche Licht der menschlichen Vernunft aus den geschaffenen Dingen mit Gewissheit erkannt werden kann. „Denn was von Ihm unsichtbar ist, seit Erschaffung der Welt, ist durch die Werke zu begreifen und wird so geschaut“ (Röm. 1,20).»
(Conc. Vat. I, Const. Dogm. „Dei Filius“, Cap. 2. De revelatione)
Magnus Striet, Professor für Fundamentaltheologie
an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Freiburg im Breisgau:
«Diese [die Gesellschaften] sind schon deshalb notwendig säkular, das heißt, sie können schon deshalb nicht auf Religion basieren, weil ihnen nicht nur faktisch, sondern auch aus intellektuellen Redlichkeitsgründen die Gewissheit Gottes abhandengekommen ist.»
(Striet kritisiert Benedikt: Gesellschaften nicht religionsfeindlich)
Ich verlange von niemandem, daß er den katholischen Glauben teilt – der Herr allein ist Richter –; aber daß ein katholischer Theologieprofessor dem früheren Papst Benedikt, vorwirft, daß er an diesem Glaube festhält, ist geschmacklos.
Im selben Artikel schreibt Professor Striet: «Man stelle sich einmal vor, ... habe es nie gegeben. ... Kann es sie in der Zukunft nicht dennoch geben? Man stelle sich vor, nie habe es in der Kirchengeschichte ... gegeben ... Kann eine solche Anerkennung in Zukunft nicht doch erfolgen?»
«Die katholische Kirche ist die einzige Institution, die den Menschen vor der erniedrigenden Sklaverei bewahrt, ein Kind seiner Zeit zu sein», befand Gilbert Keith Chesterton (gratias Laurentio Rhenanio). Könnte denn eine Kirche mit der Haltung, die Professor Striet da entworfen hat, dieser Sklaverei noch entrinnen?
Mittwoch, 6. Mai 2020
Schulen in Zeiten von Corona
«Aber vermissen die Kinder die Kita überhaupt?»
Ein Auszug: «In Deutschland hält sich hartnäckig das Gerücht, es sei der Entwicklung dienlich, am besten ab dem Alter von einem Jahr den halben bis Dreivierteltag in lärmigen Masseneinrichtungen ohne Rückzugsmöglichkeiten eingesperrt zu sein.
Zwar werden immer wieder Studien publiziert, nach denen eine qualitativ schlechte Betreuung vor allem Kleinkindern schaden kann. Aber darüber wollen nur die sprechen, die finden, dass Frauen an den Herd gehören. Bekannt ist auch, dass Kinder erst mit durchschnittlich drei Jahren vom Zusammensein mit Gleichaltrigen profitieren. Aber das volle Elterngeld wird eben nur im ersten Lebensjahr gezahlt. Oder dass Lärm gesundheitsschädlich ist und auch das kindliche Gehirn Pausen braucht.»
(Die Ligamina stehen so im Originalartikel)
Freitag, 1. Mai 2020
Sind Steuern Diebstahl?
Samstag, 18. April 2020
Teilnahme an der Liturgie durchs Netz
Samstag, 11. April 2020
Unbeachtetes in den Zeiten von Corona
Wir haben nun eine neue, die achte Seite unserer Moralia eröffnet, um – unter anderem – darauf hinzuweisen.
Donnerstag, 9. April 2020
minima philologia in tempore coronae
oder
1.
Mein Leben lang hab ich Quarantäne so gehört: Karantäne, als wenn es aus dem Französischen käme. Aktuell höre ich immer häufiger: Kwarantäne (nie jedoch Kuarantäne), als wenn es aus dem Italienischen kwäme.
2.
O vierfüßiger Jambus sei gegrüßt:
Corónavíruspándemié
3.
Wenn eine Pandemie - wie der Name sagt - sowieso das ganze Volk umfaßt, welchen Sinn hat dann die Isolation einzelner?
4
"Wehe hochmütige Corona -
Vae coronae superbae"
So sagt schon der Prophet (Is 28/1)
Sonntag, 5. April 2020
Dienstag, 24. März 2020
Wie kann ich die Heilige Messe über die Medien mitfeiern?
Doch schließlich eine Entdeckung: von der Famille Missionnaire de Notre-Dame wird eine Messe im Novus Ordo bester Form übertragen; und wenn man über fmnd.org geht, nicht über Youtube, werden seitlich auch Texte angezeigt.
Einige Worte mehr darüber sind zu finden bei Orietur Occidens.
Morgen will ich dort um 9 – ich bin in häuslicher Quarantäne, habe also Zeit – nach der Messe zum Hochfest sehen.
Korrektur:
Um ½10 ist die Messe solennelle, um 9 der Rosenkranz.
Samstag, 21. März 2020
Samstag, 7. März 2020
Sei gegrüßt, du edle Speis, Heil und Hort der Frommen
Gläubig will ich ganz und gar / dir mich anvertrauen:
M. Mainzer Cantual 1606