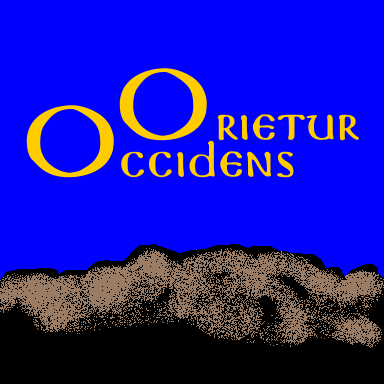«Ritus ... sint fidelium captui accommodati – Die Riten seien der Fassungskraft der Gläubigen angepaßt», so heißt es in Sacrosanctum Concilium, der Liturgiekonstitution des II. Vaticanum (34). Da steht nicht, daß die Gläubigen geistig beschränkt seien und die Riten dieser Beschränktheit angepaßt werden sollten.
Doch offenbar wurde es manchmal so verstanden.
Kürzlich schon haben wir
Norbert Lohfink (Zur Perikopenordnung für die Sonntage im Jahreskreis. I. Probleme beim „Ordo lectionum Missae“) zitiert. Er schreibt da über «eine Diskussion, die auf der entscheidenden Sitzung des nachkonziliaren „Coetus XI de lectionibus“ in Klosterneuburg einen ganzen Tag beanspruchte.» Dort wurde gesagt: «Der moderne Mensch habe keine Zeit mehr und vertrage keine langen Texte.» Wenn der „Coetus“ auch letzte Konsequenzen daraus vermied, so stellt der Autor doch fest, «daß die dadurch entstandene Sensibilität für die angebliche Unfähigkeit des modernen Menschen, einer Sache mehr als einige wenige Minuten zuzuhören, wesentlich dazu beitrug, daß der „Coetus“ mit eiserner Härte an seinen gekürzten und verstümmelten Bibelperikopen festhielt – gegen alle Einwände, und die gab es bald in Menge.»
Wer den Laien nicht zutraut, Lesungen zu verstehen, wird ihnen ebensowenig zutrauen, Riten zu verstehen. Und so mußte ich wieder und wieder erleben, daß während des Gottesdienstes der Ritus erklärt wird, daß etwa während einer Taufe ein Priester – ein ausdeutender Priester also – den Gläubigen erklärt, Chrisamsalbung, Taufkleid und Taufkerze seien «ausdeutende Zeichen». Abgesehen davon, daß die Chrisamsalbung eine hochrangige Segnung darstellt, also nicht einfach ein «ausdeutendes Zeichen» ist: meint der Priester, das könnten die Laien nicht selber verstehen?
Erklären lädt ein, sich dem rationalem Verstehen zu widmen. Aber Liturgie heißt, sich der Begegnung mit dem Herrn zu widmen. Insofern ist die Forderung, die Riten seien «fidelium captui accommodati», eher sinnvoll als das Erklären (dessen wirklicher Platz die Katechese ist).
Aber die Riten der Kirche sind von alters her «fidelium captui accommodati», sie sind von großer Ausdruckskraft. Natürlich versteht von ihnen ein kleines Kind nur ganz begrenzt etwas – aber doch mehr als nichts. Und der Königsweg zum Verstehen ist das Mitfeiern. Laien, die regelmäßig die Liturgie mitfeiern, verstehen sehr viel mehr, als so mancher Priester erwartet.
Zum Beispliel:
Was etwa bei der Taufe ein neues Kleid, was ein weißes Kleid, was eine brennende Kerze bedeutet, wird der gläubige Laie verstehen; und das eigentliche Verstehen geht über das hinaus, was mit Worten erklärt werden kann. Das in der Messe das Kreuzesopfer des Herrn wirklich gegenwärtig wir, hatte er in der Katechese zu lernen; was Teilnahme (participatio actuosa) an diesem Opfer ist, können Worte nicht erklären, das wird er durch ebendiese Teilnahme mehr und mehr verstehen.
«Ritus ... sint fidelium captui accommodati», das kann nur heißen, daß in der Liturgie Christen ständig etwas erleben, was ihre geistlichen Sinne weiter schärft, was all das, was bereits geklärt und einfach erscheint, übersteigt.
Doch wird dem Menschen nur das vorgesetzt, was er leicht versteht, wird ihm alles Verständnis vorgekaut, so entwickelt er sich nicht weiter. Und schließlich wird er sich dabei langweilen – Stimmen säkularer Autoren sind da sehr deutlich: «Was ich verstehe, interessiert mich nicht» (Günther Eich); «Kunstwerke, die der Betrachtung und dem Gedanken ohne Rest aufgehen, sind keine» (Theodor Adorno).
Es ist zu befürchten, daß so in den letzten Jahrzehnten Scharen liturgieblinder und -tauber Christen herangezogen wurden.
Ein Versehen, ein Irrweg. Oder? Karl-Rahner schrieb eint einen Aufsatz über das Thema: «Der mündige Christ». Doch was er wirklich von mündigen Christen hielt, zeigt sein und Herbert Vorgrimlers „Kleines Konzilskompendium“: «.. jene Schichten des viel zitierten und vielfach überschätzten „gläubigen Volkes“ [(die folgenden Relativsätze bieten Injurien gegen eigenständige mündige Gläubige)]. Es handelt sich um jene Schichten, denen die Heilssorge der Kirche zwar immer zu gelten hat, die aber keinesfalls zum Maßstab kirchlichen Selbstvollzugs gemacht werden dürfen … diese Wortstarken und teilweise Einflußreichen, aber in der Humanität gescheiterten Randfiguren der Kirche». Erwünscht waren also «mündige» Christen, die sich das vorbehaltlos zu eigen machten, was ihnen von der theologischen Prominenz vorgegeben wurde. Dazu eignet sich eine Liturgie, in der erklärt wird und alles vermieden wird, was zur Entwicklung eigenen geistlichen Verständnisses führen könnte.